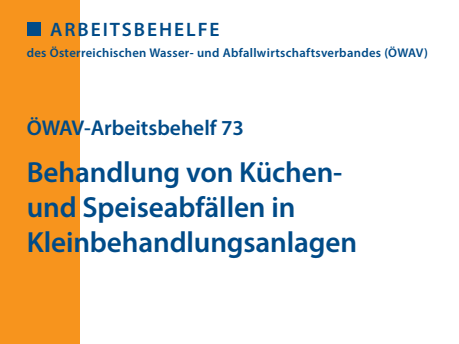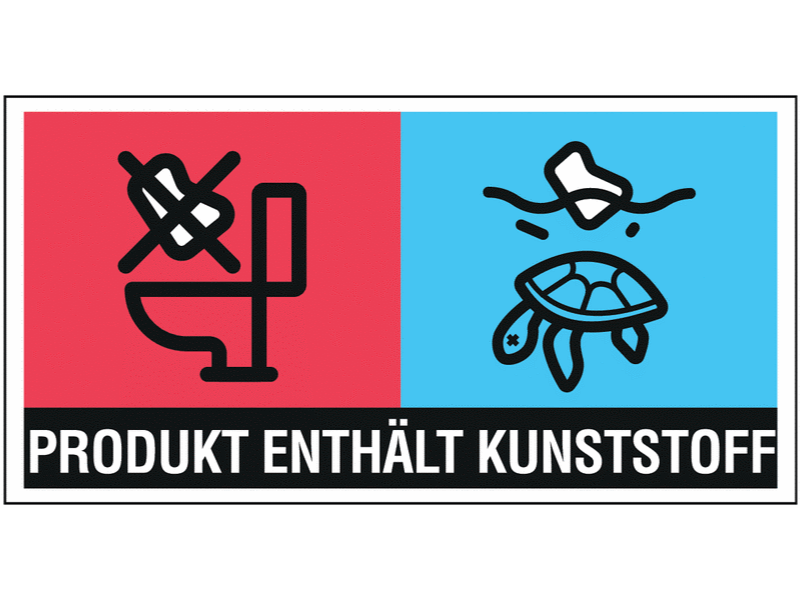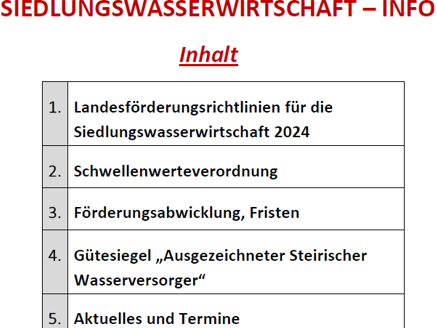PFAS – Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (Situation in Österreich)
Autor: Kaiser, A.-M., Uhl, M., Brielmann, H., Broneder, C., Cladrowa, S., Döberl, G., Fankhauser, S., Hartmann, C., Hauzenberger, I., Hohenblum, P., Lenz, K., Nemetz, S., Neubauer, C., Weisgram, M., Winter, B. (alle Umweltbundesamt); Rauscher-Gabernig, E., Steinwider, J. (alle Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit); Perthen-Palmisano, B., Schrott, H. (alle BMK) (2023) PFAS Aktionsplan – Maßnahmen zur Reduktion der Belastung von Mensch und Umwelt durch per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Österreich, 17.01.2024
Was sind PFAS?
Die Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) besteht aus mehreren tausend industriell erzeugten Chemikalien, die vielfältig in verschiedensten industriellen Verfahren sowie in Konsumentenerzeugnissen eingesetzt werden. PFAS sind fluorierte Verbindungen, die mindestens ein vollständig fluoriertes Methyl- oder Methylen-Kohlenstoffatom (ohne ein daran gebundenes H/Cl/Br/I-Atom) enthalten. Dies bedeutet, dass mit einigen wenigen Ausnahmen jede Chemikalie mit mindestens einer perfluorierten Methylgruppe (-CF3) oder einer perfluorierten Methylengruppe (-CF2-) zur Gruppe der PFAS zählt.
Vorkommen
Aufgrund ihrer thermischen und chemischen Stabilität und ihrer Fähigkeit, Öl und Wasser abzustoßen, werden sie zur Herstellung von Polymeren, Imprägnierung von Textilien, Leder und Papierwaren eingesetzt, aber auch in Feuerlöschschäumen, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen. Allerdings verfügen sie auch über umweltgefährliche und humantoxische Eigenschaften: alle PFAS sind direkt oder indirekt extrem persistent und sie verbleiben daher für sehr lange Zeiträume in der Umwelt, wenn sie einmal in diese freigesetzt wurden.
Gibt es Grenzwerte?
- Düngemittelverordnung 2004 Düngemittelverordnung 2004, BGBl. II Nr. 100/2004 (National/Schutzgut Boden/Wasser)
Im Jahr 2010 wurde für die Summe von PFOA und PFOS in Düngemitteln ein Grenzwert von 0,1 mg/kg Trockenmasse (TM) festgelegt.
- Emissionsregisterverordnung (National/Emissionen/Schutzgut Wasser)
PFOS-Emissionen in Oberflächengewässer oder in öffentliche Kanalisationen von ausgewählten großen industriellen Einleitern (z.B. Oberflächenbehandlungsanlagen, Abfallbehandlungsanlagen, Deponien) sind mit einer Mindestbestimmungsgrenze von 0,001 µg/l zu messen und im Emissionsregister zu erfassen. Die Messungen werden ab 2023 durchgeführt und liegen ab 2024 im Emissionsregister Oberflächenwasserkörper (EMREG-OW) vor. Auch die Emissionen aus kommunalen Kläranlagen mit einem Bemessungswert größer 10.000 Einwohnerwerten (EW) sind ab 2023 zu messen und ab 2024 einzumelden.
- Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2023 (National/Schutzgut Boden)
Ein Grenzwert für Böden (bzw. Aushubmaterialien) der Qualitätsklassen A1, A2-G, A2 und Qualitätsklasse BA wird unter bestimmten Voraussetzungen mit 0,002 mg/kg TM als Gesamtgehalt und mit 0,001 mg/kg TM als Eluatgehalt festgelegt. Untersuchungen sind bei Verdacht durchzuführen.
- Oberflächenwasser, PFOS und ihre Derivate, JD-UQN: 0,00065 µg/l sowie ZHK: 36 µg/l seit 2016.
Weiters gibt es Grenzwerte für Biota, Textilien oder beschichtete Materialien, Für Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse und Abfälle (Anhang IV und V).
Was ist gerade in Entwicklung?
- Entwurf für eine neue Grundwasserqualitätsnorm und Umweltqualitätsnorm (EU/Schutzgut Wasser) Vorschlag zur Überarbeitung der WRRL, der Grundwasserrichtlinie und der UQN-RL; (EU/in Entwicklung)
Vorschlag der Anwendung von PFOA-Äquivalente für 24 ausgewählte PFAS, um deren Toxizität bei der Grundwasserqualitätsnorm und UQN besser zu berücksichtigen.
- Vorschlag zur Abwasserrichtlinie (EU/Schutzgut Wasser/in Entwicklung)
Der Entwurf der überarbeiteten Abwasserrichtlinie sieht die Überwachung prioritärer Stoffe (inkl. PFOS und zukünftig auch weitere PFAS) gemäß Umweltqualitätsnormenrichtlinie (2008/105/EG) in kommunalen Kläranlagen vor. Eine vierte Reinigungsstufe (oxidative Reinigung mit Ozon und/oder adsorptive Reinigung mittels granulierter Aktivkohle) zur Entfernung von Mikroschadstoffen wird in ausgewählten Kläranlagen bis 2035 bzw. 2040 benötigt. Das Reinigungsziel ist die 80 %ige Entfernung von 6 aus 12 Indikatorsubstanzen. Es sind allerdings keine per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen als Indikatorsubstanzen enthalten.
- Novellierung der Deponieverordnung (National/Abfall/in Entwicklung)
Grenzwerte für die Deponierung von PFAS-hältigen Abfällen sind für die sich in Ausarbeitung befindliche Novelle vorgesehen. Der Entwurf der Novelle soll noch 2023 in Begutachtung gehen.
- Berichterstattung über Umweltdaten von Industrieanlagen (EU/Emissionen/in Entwicklung): Vorschlag für eine EU Verordnung über die Berichterstattung über Umweltdaten von Industrieanlagen und zur Einrichtung eines Industrieemissionsportals
Diese EU Verordnung soll die EU E-PRTR Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (166/2006) ablösen. Betreiber von Anlagen sind verpflichtet, Freisetzungen in Luft, Wasser und Boden über bestimmten festgelegten Schwellenwerten zu berichten. Anhang II der ursprünglichen Verordnung sowie des Vorschlags der EU-Verordnung beinhaltet eine Schadstoffliste inkl. Schwellenwerten, die von der Kommission im Zuge von delegierten Rechtsaktenangepasst/erweitert werden kann. Derzeit sind PFAS in dieser Liste nicht angeführt.
- Grenzwerte und Richtwerte für PFAS im Trinkwasser
Ab 12. Jänner 2026 gilt entweder 0,1 µg/l für die Summe von 20 ausgewählten PFAS („Summe der PFAS“) oder 0,5 µg/l für den Parameter „PFAS gesamt“.